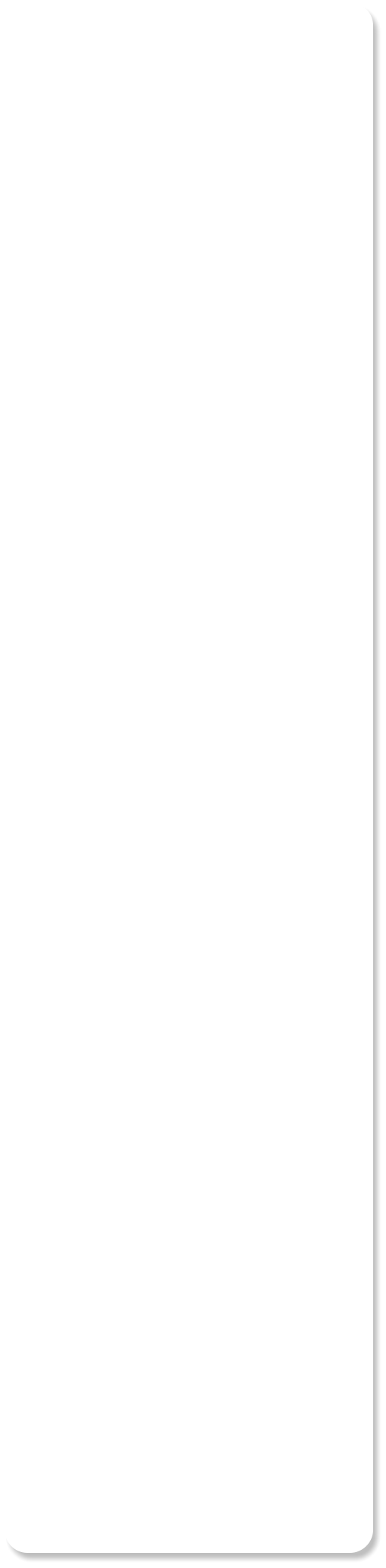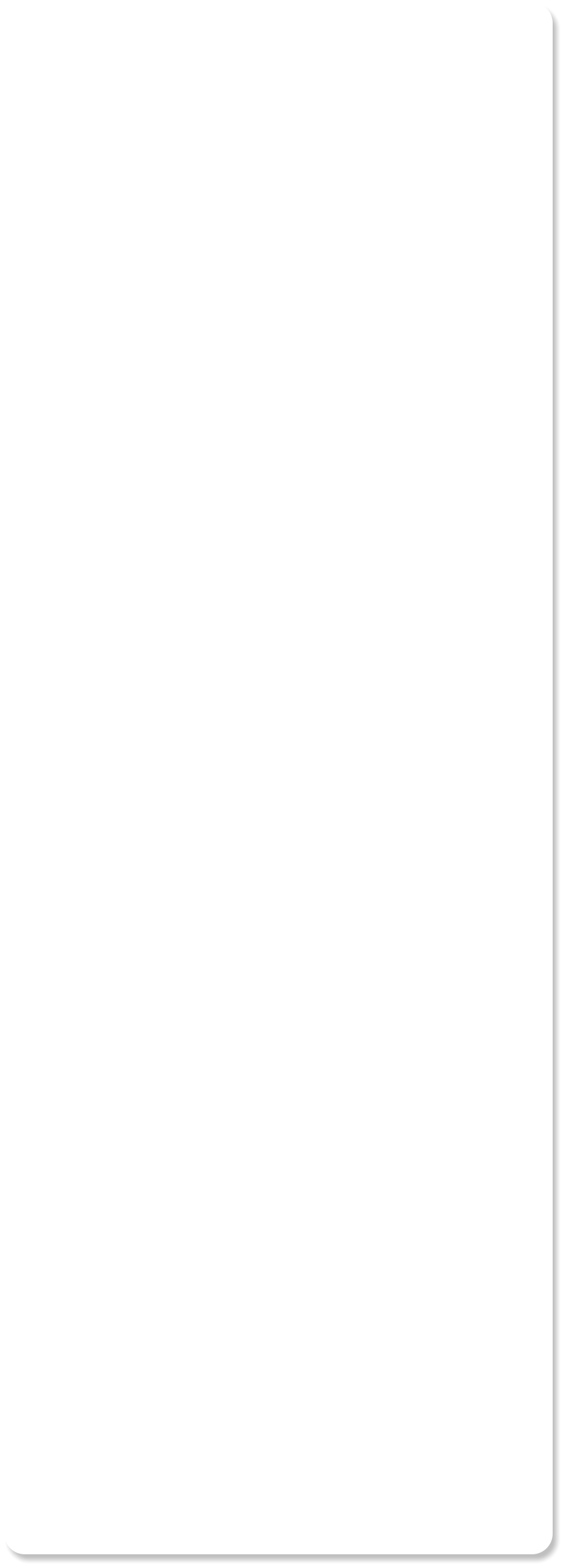



Herzlich willkommen im
Kirchengemeindeverband Göschwitz - Rothenstein

Links:
Kontakt:
Navigation:
Pfarramt Rothenstein
Pfr. Sieghard Knopsmeier
Kirchweg 3
07751 Rothenstein
Telefon:
036 424 / 226 69
Mobil:
0 173 / 201 158 1
Fax:
036 424 / 226 77
sieghard.knopsmeier@ekmd.de
Bankverbindung für Spenden
Evangelischer Kirchenkreisverband Gera
DE22 8309 4454 0300 0261 09
Startseite
•
Aktuelles
•
Gottesdienste und
Veranstaltunegn
•
Spenden
Über uns
•
Pfarrer
•
Gemeindekirchenrat
Kirchen
•
Göschwitz
•
Jägersdorf
•
Leutra
•
Maua
•
Oelknitz
•
Rothenstein
Impressum




Filialkirche der Kirche St. Laurentius zu Maua.
Beide gehörten als Pfarrlehn und Patronatskirchen zum Zisterzienserkloster Grünhain im Erzgebirge.
Die Zisterzienser hatten aus ihrem Stammland Burgund den Weinbau mitgebracht. Weil das
Erzgebirge hierfür nicht geeignet war, erwarben sie mit der Zeit Ländereien für diesen, zum Beispiel
die so genannte „Gacht“ oder „Jacht“ bei Maua (wahrscheinlich im Gebiet des heutigen Jagdberges
zwischen Maua und Leutra gelegen). Schon zu Beginn des 16. Jahrhunderts waren die Weinberge
wieder verwüstet, weil sie über die Entfernung nur noch schwer zu bestellen und zu versorgen
waren.
Noch länger genutzt wurde ein in vortrefflicher Lage, gleich oberhalb der Kirche am Eselsweg nach
Oßmaritz gelegener Weinberg, der „Herrenweingarten“ oder „Herrenberg“ genannt wurde.
Auch die Flurbezeichnungen „Mönchsleite“ in Leutra und „Mönchsberg“ und „Mönchsgraben“ in
Maua sind Hinweise auf die klösterlichen Bezüge der Gegend.
Eine Volkssage erinnerte noch an die Zugehörigkeit beider Kirchen zu einem Kloster. Wegen der in
Vergessenheit geratenen Zuordnung zu Grünhain, hat man dieses später in Leutra selbst gesucht.
Die Kirche St. Nikolaus war ursprünglich romanisch (d.h. nach Art der Römer gebaut, besonders
nach deren Bogen- und Wölbetechnik mit Bruchsteinen und behauenen Quadern), erkennbar an der
heute noch benutzten Eingangstür an der Südseite mit halbkreisförmigem Bogen. Ebenfalls
wahrscheinlich schon aus dem 12. Jahrhundert, der Ursprungszeit der Kirche, stammt der Taufstein.
Die Kirche ist eine für Thüringen typische Chorquadratkirche, bei der sich an einen rechteckigen Saal
in Richtung Osten ein ebenfalls rechteckiges Altarhaus, Chor genannt, anschließt.
In der Übergangszeit von Romanik zur Gotik um 1250 wurde der Chor dann zum Turm aufgestockt.
Die Kirche diente mit ihren dicken Mauern als Wehrkirche, also als Fluchtburg, in der die
Dorfbewohner mit ihrer Habe bei Überfällen Schutz suchten. An diesen Zweck erinnern auch noch
an Reste eines Wehrganges und einer zusätzlichen mit Schießscharten und Ecktürmen versehenen
Mauer. Der Eingang wurde durch eine schwere eisenbeschlagene Tür gesichert. Für den Schatz der
Kirche, die vasa sacra, also Kelch, Patene, Hostienbüchse und Weinkanne wurde eine Holztruhe
angefertigt, die aus einem Baum besteht.
Besonderes Kleinod der Kirche ist das auf der Ostseite gelegene Elfpassfenster, die Rosette von
Leutra. Es weist in seiner Symbolik auf die elf Jünger Jesu hin, die sich am Ostermorgen
versammelten.
Judas, der zwölfte, hatte sich ja nach seinem Verrat erhängt. Dieses architektonische Symbol soll in
Verbindung zu einem liturgischen Ritus gestanden haben, nach dem das Abendmahl in der
Ostermesse genau in dem Moment eingesetzt wurde, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch den
Elfpass auf den Altar fielen. Spätestens der Einbau des Hochaltars hat diesem Brauch ein drastisches
Ende bereitet.
Auf der Südseite des Langhauses ist unter der Traufe ein roher Kopf eingemauert. Nach einer
örtlichen Überlieferung soll er an einen beim Bau herunter gestürzten Arbeiter erinnern, was
allerdings bei einem Sakralbau eher ungewöhnlich wäre. Eine andere Version vermutet, dass es sich
um eine Abbildung des Patrons, also des Nicolaus handelt. Heilige wurden allerdings, damit sie klar
zu erkennen waren, meistens mit ihren Attributen dargestellt, also Nicolaus mit der Bischofshaube,
dem Bischofsstab und den drei Goldäpfeln, die hier fehlen. Bleibt noch der besonders in der
Romanik weit verbreitete Brauch, im Dachbereich, meistens an den Sparrenköpfen kunstvoll
gestaltete, aber möglichst grässliche Fratzen und Monsterfiguren anzubringen. Dies sollte der
Dämonenabwehr dienen, indem diesen sozusagen ein Spiegel vorgehalten wurde und sie
erschrocken umdrehen sollten. Dadurch wurde die Kirche im doppelten Sinne zur Wehrkirche. Das
eher freundliche Gesicht der Gestalt könnte von einer späteren Bearbeitung herrühren. Auch die
Decke, das Gestühl, die Emporen- und Altareinbauten, die großen rechteckigen Fenster und die
Außentreppe stammen erst aus dem 17. bis 19. Jahrhundert.
Die Orgel wurde von der Firma Eiffert/ Stadtilm gebaut.
Der größte Teil dieser Umgestaltungsarbeiten erfolgte um 1791.